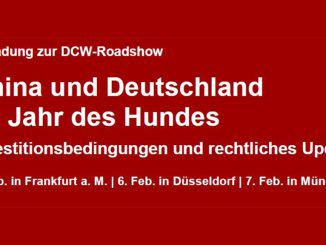Jedes Jahr ist es auf ein Neues zu beobachten: Kaum ist der Fasching vorbei, füllen sich die Supermarktregale mit Schokoladenhasen. Nicht mit einem, nicht mit fünf – sondern mit Dutzenden. Manche sitzen, manche stehen, manche lachen uns fröhlich an und andere blicken elegant in die Ferne. Es gibt sie aus Vollmilch, Zartbitter, weißer Schokolade, laktosefrei, vegan oder gefüllt. Sie heißen Goldhase, Schmunzelhase, Vegan Bunny oder einfach Osterhase.
Warum eigentlich? Reicht nicht ein Hase? Oder zwei?
Die kurze Antwort: Nein – und zwar aus mehreren ökonomisch interessanten Gründen. Die Vielfalt ist nicht nur schön, sondern auch rational erklärbar. Sie ist das Ergebnis aus Konsumentenpräferenzen, strategischer Produktpolitik und strukturellen Marktgegebenheiten. In diesem Beitrag werfen wir einen ökonomischen Blick hinter die schillernde Metallfolie der Schoko-Osterhasen.
Wir lieben Vielfalt
In der Volkswirtschaftslehre gibt es zwei grundlegende theoretische Ansätze, um die Nachfrage nach Produktvielfalt zu erklären: den Ideal Variety Approach und das Konzept der Love of Variety. Beide sind intuitiv verständlich – beschreiben aber unterschiedliche Motive.

Laut dem Ideal Variety Approach haben wir alle ein ideales Produkt im Kopf, das unseren Vorlieben am besten entspricht. Je mehr unterschiedliche Varianten ein Markt bietet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Produkt gibt, das sehr nahe an unsere Idealvorstellung herankommt. Für Ostern heißt das: Der eine mag seinen Hasen lieber zartbitter und elegant, die nächste bevorzugt einen großen, bunten Hasen mit Nussstücken. Die Vielfalt ermöglicht es, dass wir alle etwas finden, was möglichst gut zu unserem Geschmack passt.
Der zweite Erklärungsansatz geht über individuelle Präferenzen hinaus: Love of Variety besagt, dass wir Vielfalt an sich schätzen. Es geht nicht nur darum, das eine perfekte Produkt zu finden, sondern um Abwechslung, Erlebnis, Symbolik. Man kauft nicht einen Schokohasen – man kauft verschiedene, weil es schön ist, unterschiedliche Dinge zu verschenken oder auszuprobieren. So bekommt die Liebste den stilvollen Goldhasen, die Kinder einen lustigen Schmunzelhasen und die Großeltern vielleicht einen beschwipsten Osterhasen. Vielfalt stiftet hier nicht nur individuellen Nutzen – sie erfüllt auch soziale Funktionen, Rituale und ästhetische Erwartungen.
Unternehmen brauchen Vielfalt
So weit, so konsumentenseitig. Aber warum spielen die Unternehmen mit? Wäre es nicht einfacher – und günstiger –, nur einen Standardhasen anzubieten?
Die Antwort liegt in der Marktstruktur. Der Osterschokoladenmarkt ist ein Paradebeispiel für ein differenziertes Oligopol: Wenige große Anbieter (z. B. Lindt, Ferrero oder Nestlé) teilen sich den Markt und sie konkurrieren weniger über den Preis als über die Produkteigenschaften.
Nehmen wir an, alle Schokohasen wären absolut gleich: gleiche Größe, gleiche Schokolade, gleiche Verpackung. Wenn Lindt seinen Hasen für 3,00 € verkauft und Ferrero denselben für 2,90 €, würden wir bestimmt zum günstigeren Anbieter wechseln – warum sollte man auch mehr als nötig zahlen? Ein höherer Preis wäre nicht mehr konkurrenzfähig. Um nicht das Nachsehen zu haben, müsste Lindt den Preis auf 2,89 € senken und Ferrero würde nachziehen. Dieses „Preis-Unterbieten“ setzt sich fort, bis der Preis gerade noch reicht, um die Produktionskosten zu decken – aber keinen Cent mehr. In der Ökonomie wird dies als Bertrand-Paradoxon bezeichnet und zeigt, dass reiner Preiswettbewerb bei homogenen Produkten für Unternehmen ruinös ist.

Genau deshalb versuchen Unternehmen, ihre Produkte einzigartig zu machen. Durch geschickte Produktdifferenzierung, also Design, Verpackung, Geschmack, Markenimage oder Werbebotschaften, verwandeln sie ein eigentlich homogenes Gut (Schokolade in Hasenform) in ein emotional aufgeladenes Produkt mit individueller Bedeutung.
Der Goldhase von Lindt ist ein gutes Beispiel: Er ist nicht günstiger als andere, ganz im Gegenteil. Aber er wird mit Qualität, Tradition und Exklusivität assoziiert. Diese Differenzierung wirkt wie ein Schutzschild gegen den Preiswettbewerb. Viele vergleichen nicht mehr rein den Preis, sondern auch das Image, die Geschichte, die Verpackung und greifen bereitwillig tiefer in die Tasche.
So entkommen die Anbieter dem Bertrand-Dilemma und verdienen auch in einem engen Markt mit wenigen Wettbewerbern gute Margen.
Ein Hoch auf die Vielfalt!
Die bunte Welt der Osterschokohasen ist also nicht nur süß, sondern auch lehrreich. Sie zeigt, wie Unternehmen in oligopolistischen Märkten durch Produktdifferenzierung Gewinne sichern und wie wir davon teilweise profitieren (auch wenn es nicht ganz billig ist).
Vielfalt ist hier kein Überangebot, sondern ein Marktgleichgewicht zwischen strategischem Angebot und differenzierten Präferenzen. Und vielleicht ist das auch eine kleine Parabel auf das Osterfest selbst: Dass es nicht um das eine Richtige geht, sondern um ein Miteinander aus Verschiedenem.
In diesem Sinne: Frohe Ostern und viel Freude bei der Hasenwahl!